DENKMALSCHUTZ ☰ projekt HISTORISCHE GRENZE

Die Fraischsteine im Trubachtal
N-BA-1607
Die Fraischgrenze Obertrubach (N-BA 1607) grenzt die Hoheitsrechte der Blutgerichtsbarkeit und des höheren Jagdrechts voneinander ab.
Dies wird auf dem Grenzstein durch das Schwert für die Blutgerichtsbarkeit und das höhere Jagdrecht durch das Hifthorn repräsentiert.
Die Grenzlinie entstand durch den sog. "silbernen Vertrag" vom 22. Februar 1607, in dem die Reichsstadt Nürnberg und das Hochstift Bamberg die teilweise strittige Grenzlinie festgelegt und dann mit insgesamt 25 Grenzsteinen markiert haben.
Von den ehemals 25 Grenzsteinen, die in der Region entlang der Grenzlinie gesetzt worden sind, haben sich bis heute 16 erhalten.
Sie stehen unter Denkmalschutz.
Der Name "silberner Vertrag" resultiert vermutlich aus dem Umstand, dass die Streitigkeiten zwischen Bamberg und Nürnberg vornehmlich auf den in diesem Bereich vorhandenen Bergbau zurück gingen und es dort u.a. auch Silber gab, das gefördert wurde.
Der Vertrag von 1607 regelte mit den Zuständigkeiten auch den Abbau in diesen Bergwerken.
Das Hochstift Bamberg (Kurzübersicht)
Das Hochstift Bamberg bildet im Unterschied zum Erzbistum Bamberg die weltliche Macht ab. Dem Hochstift stand ein Fürstbischof vor, der die Herrschaftsansprüche durchsetzte.
Das Hochstift Bamberg entwickelte sich bis ins 14. Jahrhundert aus einer Summe von Hochgerichtssprengeln (Fraisch) des Radenzgaues und der angrenzenden Gaugrafschaften sowie heimgefallenen Vogteien.
Es umfasste in etwa knapp die Hälfte der Diözese und reichte im Westen in das Würzburger Diözesangebiet.
Der Ausbau des Territoriums wurde durch die Finanzkraft des Bistums und das Aussterben hochfreier Geschlechter ermöglicht. Das Hochstift Bamberg war kein geschlossenes Territorium. Seit dem Aufstieg des Stiftsadels in Reichsritterschaft im 16. Jahrhundert war es von zahlreichen, oft protestantischen ritterschaftlichen Herrschaften durchsetzt. Über die 1759 verkauften Besitzungen in Kärnten konnte Bamberg keine Reichsunmittelbarkeit ausbilden. 1802/03 wurde das Hochstift säkularisiert und fiel an das Königreich Bayern.
Fürstbischof Johann Phillipp von Gebsattel
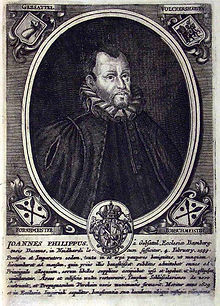
Johann Philipp von Gebsattel (* 13. Mai 1555; † 26. Juni 1609) war von 1599 bis zu seinem Tode 1609 Fürstbischof des Hochstiftes Bamberg.
Johann Philipp von Gebsattel stammte aus der fränkischen reichsfreien Adelsfamilie derer von Gebsattel. Der namensgebende Ort Gebsattel ist heute eine Gemeinde im mittelfränkischen Landkreis Ansbach.
In der Regierungszeit von Papst Clemens VIII. und Kaiser Rudolf II. wurde er 1599 zum Bischof gewählt. Er baute die Giechburg um 1600 zu ihrer beachtlichen Größe aus.[1]Damit entstand aus einer Burgruine eine späte Höhenburg, die den Ansprüchen der Wehrhaftigkeit einer zeitgemäßen Burg nicht mehr entsprach und besser als ein Renaissanceschloss zu bezeichnen war. Weitere monumentale Bautätigkeiten begann er mit der späteren Neuen Residenz in Bamberg.
Er galt bereits zu seiner Zeit als umstritten. Man sagt ihm einen gewissen dekadenten Lebensstil, zum Beispiel das Konkubinat, nach und eine damit verbundene Vernachlässigung seiner Pflichten als Bischof.. Er trat zumindest nicht in die Fußstapfen seiner Vorgänger, die energische Vertreter der Gegenreformation waren.
Grabdenkmal Johann Philipp von Gebsattels in der Michaelskirche
Sein Grabdenkmal befindet sich seit der Stilrestaurierung des Domes von Bamberg in der Michaelskirche im linken Seitenschiff (siehe auch Kloster Michelsberg).

Die Grenzlinie von 1607
Bereits im Jahr 1537 hatte es in Forchheim einen Vertrag zwischen dem Hochstift Bamberg und der Freien Reichsstadt bezüglich der Fraischgrenze gegeben. Der Vertrag von 1607 veränderte die Grenzlinie in einigen Teilen.
So war nun der Kirchplatz der Ausgangspunkt der Grenzsteinlinie, die mit 25 Grenzsteinen versteint werden sollte.
Sie verlief dann über die Gemarkungen Pottenstein, Betzenstein/ Ottenberg in die Nähe von Bronn.
Die Grenzlinie entstand durch den sog. "silbernen Vertrag" vom 22. Februar 1607, wo die Reichsstadt Nürnberg und das Hochstift Bamberg die teilweise strittige Grenzlinie festgelegt und dann mit insgesamt 25 Grenzsteinen markiert haben.
Von diesen sind bis heute 16 Grenzsteine erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Sie weisen keine einheitliche Listennummer auf, sondern sind offensichtlich einzeln erfaßt worden.
Nachfolgend die Liste der noch existierenden Grenzsteine.
Die Grenzsteine
Die Grenzsteine weisen auf der Nürnberger Seite das Wappen der Stadt Nürnberg auf und auf der Bamberger Seite das des Hauses von Gebsattel. Der Fürstbischof hatte sich hier verewigen lassen.
Das Schwert über dem Wappen steht für die Blutgerichtsbarkeit, das Hifthorn unter dem Wappen für das höhere Jagdrecht.
Der Grenzverlauf in der Karte
Die Grenzsteine

N-BA-1607-001
Denkmalschutz: D-4-74-156-35
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4453192, 5506694
UTM 32U 669454, 5507381
WGS 84 (lat/lon) 49.69509, 11.34974
Höhe 430 m

N-BA-1607-002
Denkmalschutz: D-4-74-156-5
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4453640, 5506888
UTM 32U 669894, 5507593
WGS 84 (lat/lon) 49.69687, 11.35593
Höhe 526 m

N-BA-1607-003
Denkmalschutz: D-4-74-156-6
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4453682, 5506673
UTM 32U 669944, 5507380
WGS 84 (lat/lon) 49.69494, 11.35653
Höhe 516 m

N-BA-1607-004
Denkmalschutz: D-4-74-156-7
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4453845, 5506768
UTM 32U 670103, 5507481
WGS 84 (lat/lon) 49.69581, 11.35877
Höhe 541 m

N-BA-1607-006
Denkmalschutz: D-4-74-156-10
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4453991, 5506671
UTM 32U 670253, 5507390
WGS 84 (lat/lon) 49.69495, 11.36081
Höhe 514 m

N-BA-1607-007
Denkmalschutz: D-4-74-156-8
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4454099, 5506756
UTM 32U 670357, 5507480
WGS 84 (lat/lon) 49.69572, 11.36230
Höhe 539 m

N-BA-1607-008
Denkmalschutz: D-4-74-156-9
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4454141, 5506942
UTM 32U 670392, 5507667
WGS 84 (lat/lon) 49.69740, 11.36286
Höhe 516 m

N-BA-1607-009
Denkmalschutz D-4-74-156-11
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4454280, 5507106
UTM 32U 670524, 5507836
WGS 84 (lat/lon) 49.69888, 11.36476
Höhe 499 m

N-BA-1607-010
Denkmalschutz D-4-74-156-12
Gemeinde Obertrubach
Gemarkung Obertrubach
GK4 4454483, 5507321
UTM 32U 670718, 5508059
WGS 84 (lat/lon) 49.70083, 11.36755
Höhe 488 m

N-BA-1607-011
Denkmalschutz D-4-72-179-145
Gemeinde Pottenstein
Gemarkung Leienfels
GK4 4455203, 5507590
UTM 32U 671427, 5508357
WGS 84 (lat/lon) 49.70330, 11.37750
Höhe 529 m

N-BA-1607-013
Denkmalschutz D-4-72-179-145
Gemeinde Pottenstein
Gemarkung Leienfels
GK4 4455558, 5507888
UTM 32U 671771, 5508668
WGS 84 (lat/lon) 49.70600, 11.38240
Höhe 546 m

N-BA-1607-015
Denkmalschutz D-4-72-179-145
Gemeinde Pottenstein
Gemarkung Leienfels
GK4 4456125, 5507865
UTM 32U 672338, 5508668
WGS 84 (lat/lon) 49.70584, 11.39026
Höhe 546 m

N-BA-1607-016
Denkmalschutz D-4-72-118-44
Gemeinde Betzenstein
Gemarkung Ottenberg
GK4 4457316, 5507950
UTM 32U 673525, 5508800
WGS 84 (lat/lon) 49.70669, 11.40677
Höhe 518 m

N-BA-1607-018
Denkmalschutz D-4-72-118-44
Gemeinde Waidacher Forst
Gemarkung Waidacher Forst
GK4 4457071, 5508378
UTM 32U 673263, 5509219
WGS 84 (lat/lon) 49.71052, 11.40332
Höhe 533 m

N-BA-1607-019
Denkmalschutz D-4-72-118-44
Gemeinde Betzenstein
Gemarkung Ottenberg
GK4 4457877, 5508572
UTM 32U 674060, 5509445
WGS 84 (lat/lon) 49.71232, 11.41448
Höhe 513 m

N-BA-1607-020
Denkmalschutz D-4-72-118-44
Gemeinde Betzenstein
Gemarkung Ottenberg
GK4 4457862, 5508155
UTM 32U 674062, 5509028
WGS 84 (lat/lon) 49.70857, 11.41431
Höhe 497 m




